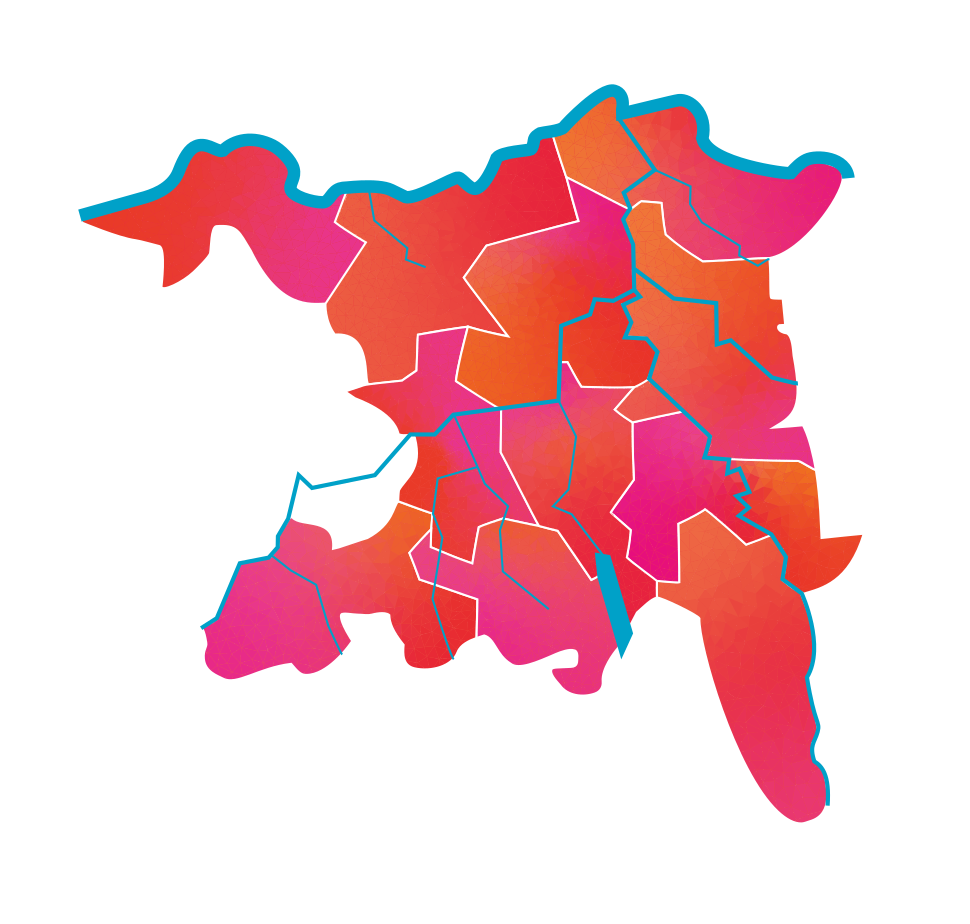Von Annick Grand, Leitung Kirchliche Regionale Sozialdienste, Caritas Aargau
Haushalte mit weniger als 4000 Franken Monats einkommen geben im Schnitt 35 Prozent ihres Budgets für die Miete aus – deutlich über der 25-Prozent-Schwelle, ab der andere Grundbedürfnisse gefährdet sind. Besonders hart trifft es die Menschen mit wenig finanziellen Mitteln. Armutsbetroffene Menschen sind auf dem Wohnungsmarkt doppelt benachteiligt. Erstens konkurrieren sie mit vielen Interessierten um wenige günstige Objekte. Zweitens haben sie wegen Vorurteilen, unsicherer Einkommen oder Sozialhilfeabhängigkeit geringere Chancen, überhaupt den Zuschlag zu erhalten.
Viele Betroffene wenden sich deshalb an Beratungsstellen, um Unterstützung bei der Wohnungssuche zu erhalten. Doch auch dort stossen Fachpersonen zunehmend an ihre Grenzen: Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist so gravierend, dass selbst gut vernetzte Profis oft keine passenden Angebote mehr finden. Diese Hilflosigkeit ist Ausdruck eines strukturellen Problems, das durch individuellen Einsatz allein nicht gelöst werden kann.
Fehlende Verpflichtungen – und politische Antworten
In Bezug auf die Förderung von preisgünstigem Wohnraum lassen sich aus den Bundesgesetzen keine Verpflichtungen für die Kantone ableiten. Die kantonalen Gesetze wiederum begründen keine Förderpflichten für die Gemeinden. Bund und Kanton beschränken sich auf die Zusprechung von Finanzhilfen. Die konkrete Förderung von preisgünstigem Wohnraum sowie die Sicherstellung des Zugangs zu entsprechenden Angeboten liegen im Ermessen der Gemeinden, ohne dass dazu eine ausdrückliche Verpflichtung besteht. Diese wiederum haben wenig Anreiz, preisgünstigen Wohnraum anzubieten.
Hier setzt die Mietpreisinitiative an. Sie will in der Bundesverfassung festhalten, dass ein Mietzins missbräuchlich ist, wenn er die tatsächlichen Kosten zuzüglich einer angemessenen Rendite übersteigt oder auf einem übersetzten Kaufpreis beruht. Zudem sollen Mieten automatisch und regelmässig überprüft und gegebenenfalls gesenkt werden – auch auf Verlangen der Mieterschaft.
Befürworter:innen sehen darin ein dringend nötiges Korrektiv in einem aus dem Gleichgewicht geratenen Markt. Die Gegenseite warnt vor Eingriffen in die Eigentumsgarantie und sinkender Investitionsbereitschaft. Doch ohne verbindliche Regulierungen drohen weiter steigende Mieten und verschärfte Wohnungsknappheit. Wohnen darf kein Privileg werden – es muss für alle tragbar bleiben.

«Ein Markt, der Grundbedürfnisse nicht sichern kann, braucht politische Korrekturen – nicht nur gute Absichten.»